REICHSHOF
Rückbesinnung als Auftrag für die Zukunft
Reichshof - Aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung von der Nazi-Diktatur erinnerte Gerhard Jenders gestern im Reichshofer Ratssaal an Schicksale von „Displaced Persons“, deren weitere Lebenswege sich seinerzeit in der Denklinger Burgbergklinik entschieden.
Von Ute Sommer
Als ortsbildprägendes Gebäude liegt die Denklinger „Burgbergklinik“ weithin sichtbar oberhalb des Ortskerns, doch kaum jemand kennt die wechselvolle Geschichte des Domizils, das während der Kriegsjahre als Wehrmachtslazarett, in der Folgezeit von 1945 bis 1951 als Heilstätte für gequälte, oftmals an Lungentuberkulose erkrankte „Displaced Persons“ (DP) diente. Über 1.000 Menschen konnte hier das Leben gerettet werden, 91 Opfer jedoch, für die jede Hilfe zu spät kam, fanden ihre letzte Ruhestätte auf dem örtlichen Friedhof.
Während zweijähriger Recherchen in Dokumenten des Arolsen Archivs (Internationales Zentrum über NS-Verfolgung) und standesamtlichen Sterbeurkunden und Gräberlisten rekonstruierte der Vorsitzende des Vereins „Oberberg ist bunt, nicht braun“, Gerhard Jenders, schlaglichtartig die Geschichte der Burgbergklinik und die Schicksale der jungen Männer und Frauen, deren Namen sich auf den Grabplatten des Denklinger Friedhofs finden. „Die Erinnerung an das, was war, muss erhalten werden und als Auftrag für die Zukunft in aktuelle Bezüge gesetzt werden“, begründete Jenders gestern seine unermüdliche Motivation um Erhalt der Erinnerungskultur.
Laut der gesichteten Quellen wurden in den 200 Betten des Lazaretts in der Nachkriegszeit 1.150 entwurzelte NS-Opfer behandelt, die KZ-Haft, Kriegsgefangenschaft oder Zwangsarbeit überlebt hatten und aus verschiedensten Gründen nicht in die Heimat zurückkehren konnten. Einer von ihnen war der Berliner Willi Kessler, der nach Befreiung aus dem Vernichtungslager Ausschwitz auf der Suche nach überlebenden Familienmitgliedern, am 2. Januar 1946 in der Lungenheilstätte Denklingen strandete. Nach seiner Heirat blieb er im Oberbergischen und dokumentierte 1984 seine Erinnerungen an die bestialische Haft in Auschwitz in der Veröffentlichung „Einer muss überleben“.
Stellvertretend für das Gedenken an Abermillionen von Kriegsopfern beschrieb Gerhard Jenders von ihm in Erfahrung gebrachte Informationen zu einigen der in Denklingen bestatteten „Displaced Persons“, die vielfach aus Osteuropa, Russland, Sibirien, dem Baltikum oder dem ehemaligen Jugoslawien stammten. Mit detaillierten Eckdaten aus Lebensläufen, Berufsangaben, Beschreibungen von Familienkonstellationen, Stationen der Kriegs-Odysseen und die Wiedergabe persönlicher Anmerkungen der Denklinger DPs rückte Jenders deren Entwurzelung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, ließ deren Traumatisierung erahnbar werden.
So starb die gebürtige Polin Marija Adamcewicz laut Gräberliste und Sterbebuch der Gemeinde Reichshof dreizehnjährig an kavernöser Lungentuberkulose. Das jüngste der vier Kinder von Jozef und Emilia Adamcewicz, aus „Jankowice bei Stolpci“, scheint während der Kriegswirren von der Familie getrennt worden zu sein. Der lettische Lehrer Janis Taurins wurde, nach seiner Deportation, von August 1944 bis zum Kriegsende als Zwangsarbeiter in verschiedenen Fabriken ausgebeutet, ab September 1949 lautet seine Adresse „DP Hospital Denklingen“, wo er am 12. Januar 1950 im Alter von 30 Jahren an Lungentuberkulose verstirbt.

[Der Text auf den .Gedenktafeln wurde von Schülern der Gesamtschule Reichshof erarbeitet.]
Als Angehörige der Volksgruppe der Sinti und Roma stammte die 1920 geborene Magdalena Horvath aus Ungarn und wurde mit 19 Jahren im Lager Ravensbrück als „arbeitsscheu“ und „Zigeunerin“ registriert. Wegen der Häufigkeit des Nachnamens „Horvath“ lässt sich der weitere Lebensweg von Magdalena nicht mit Sicherheit rekonstruieren, doch leistet sie im KZ wohl fünf Jahre Zwangsarbeit und erkrankt schwer. Eine Akte des „Care and Maintenance“- Programms der UN-Flüchtlingsorganisation IRO von 1950 sagt aus, dass sie sich bereits seit fünf Jahren zur Behandlung in der Burgbergklinik aufhält und ein weiteres Dokument gibt über ihre Zukunftspläne Auskunft, sich nach Genesung in den USA niederlassen zu wollen. Magdalena Horvaths Zukunft endete bereits am 1. April 1951 mit ihrem Versterben fern der Heimat, im oberbergischen Denklingen.
Jenders dankte der Gemeinde Denklingen für die Errichtung von Gedenktafeln, die am Burgberg, im Rathaus und auf dem Friedhof auf das Schicksal der Displaced Persons verweisen. „Es ist unsere Pflicht den Anfängen von Terror und Gewalt im Kleinen wie im Großen zu begegnen“, unterstrich Bürgermeister Rüdiger Gennies mit Blick auf den Tag der Befreiung vom menschenverachtenden Nationalsozialismus.
Weitere Informationen unter www.oberberg-ist-bunt.org.



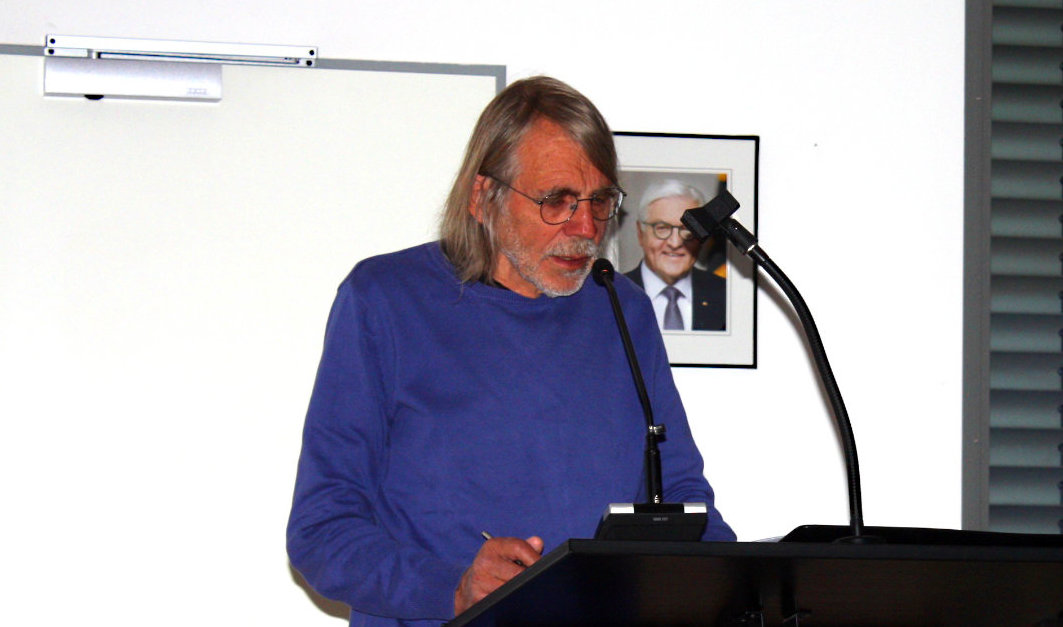





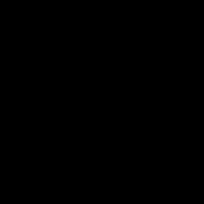


ARTIKEL TEILEN